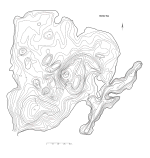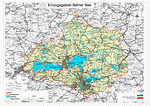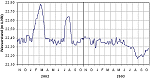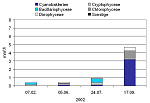Jahr der Untersuchung: 2002
13.1 Wasserstände
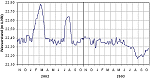
(Bitte anklicken zum Vergrößern!)
13.2 Physikalisch-chemische Daten
8.2.1 Tiefenprofile von Temperatur und Sauerstoff

(Bitte anklicken zum Vergrößern!)
8.2.2 Physikalisch-chemische Daten im Überblick

(Bitte anklicken zum Vergrößern!)
Erläuterungen zu Einheiten, Parametern und Messmethoden
13.3 Lebensgemeinschaften
8.3.1 Biovolumen der dominierenden Phytoplanktongruppen
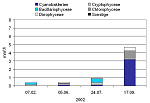
(Bitte anklicken zum Vergrößern!)
8.3.2 Unterwasservegetation
Die Unterwasservegetation ist im Behler See insgesamt mit 14 submersen Arten, von denen fünf nach den Roten Listen der Farn- und Blütenpflanzen Schleswig-Holsteins (MIERWALD & BELLER 1990) oder der Armleuchteralgen Schleswig-Holsteins (GARNIEL & HAMANN 2002) gefährdet, beziehungsweise vom Aussterben bedroht sind, praktisch an der gesamten Uferlinie gut entwickelt. Nur im Ostteil, im Langensee, ist ihr Vorkommen etwas spärlicher. Die Bestände dehnen sich in Wassertiefen bis 5 m, zum Teil auch unter 6 m, aus. Besonders in Flachwasserbereichen ist der Sumpf-Teichfaden Zannichellia palustris häufig zu beobachten. Überall anzutreffen und den Bereich bis 2 m Wassertiefe vielfach beherrschend ist das Kamm-Laichkraut Potamogeton pectinatus. Sehr häufig in diesem Bereich kommt außerdem das Durchwachsene Laichkraut Potamogeton perfoliatus und der Spreizende Wasserhahnenfuß Ranunculus circinatus vor. Das Rauhe Hornblatt Ceratophyllum demersum und das gefährdete Zwerg-Laichkraut Potamogeton pusillus treten auch in größeren Beständen, wenn nicht sogar in Massenbeständen zum Beispiel westlich des Großen Warders, vermehrt in tieferen Bereichen auf. Häufig bis verstreut sind die Kanadische Wasserpest Elodea canadensis, das gefährdete Ährige Tausendblatt Myriophyllum spicatum und das stark gefährdete Stachelspitzige Laichkraut Potamogeton friesii im See zu finden. Der vom Aussterben bedrohte Grasblättrige Froschlöffel Alisma gramineum siedelt in Wassertiefen von 1 m bis um 3 m vor allem am West- und Nordufer. Die gefährdete Gegensätzliche Armleuchteralge Chara contraria kommt vom Flachwasser bis unter 4 m Wassertiefe häufig vor, sie bildet am Nord- und am Südufer sowie vor dem Westufer des Großen Warders rasige, zum Teil großflächige Bestände, vor allem aber in Wassertiefen von 2 bis 3 m. Die Zerbrechliche Armleuchteralge Chara globularis tritt ebenfalls häufig in Erscheinung, allerdings in kleineren Populationen, die eine Tiefe von unter 5 m erreichen können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Behler See eine mäßig artenreiche und gut entwickelte submerse Vegetation besitzt, die 14 Arten beinhaltet, von denen 5 gefährdet beziehungsweise vom Aussterben bedroht sind. Es erscheint in Anbetracht der großen Tiefenausdehnung der Vegetation ihre Artenzahl etwas reduziert. Obwohl die großflächigen Armleuchteralgenrasen besonders hervorzuheben sind, weisen auch bei diesen Arten andere vergleichbare Gewässer im Raum Plön eine höhere Artenzahl und eine mehr oder weniger deutliche Zonierung auf. Trotz dieser Einschränkungen ist der Erhalt der submersen Vegetation des Behler Sees von landesweiter Bedeutung.
13.4 Bewertung und Empfehlungen
8.5.1 Bewertung
Der Behler See hat nach LAWA (1998) einen oligotrophen bis mesotrophen Referenzzustand (potenziell natürlicher Zustand), der durch die potenziell natürliche Bodenauswaschung und die Verweildauer des Wassers im See bestimmt wird. Tatsächlich befindet sich der See gegenwärtig in einem schwach eutrophen Zustand. Aus der Differenz zwischen Istzustand und Referenzzustand ergibt sich die Bewertungsstufe 2 bis 3. Daraus lässt sich ein gewisser Handlungsbedarf zur Entlastung des Sees erkennen, wobei ein mesotropher bis schwach eutropher Zustand anzustreben ist.
Die derzeitige Phosphorbelastung des Sees von 1,65 g/a*m² Seefläche ist hoch und liegt weit über der mittleren Phosphor-Belastung schleswig-holsteinischer Seen von 0,6 g/a*m² Seefläche. Die größte Nährstofffracht gelangt über die Schwentine in den Behler See. Ihr Anteil am Gesamteintrag erreicht beim Phosphor 82 % und beim Stickstoff 68 %. Andererseits wirken der Dieksee und die oberen Schwentineseen für das Wasser aus 85 % des Gesamteinzugsgebietes (Tabelle 8) durch Sedimentation und Denitrifikation als Nährstoffsenken. Der Schluensee, der Schöhsee und der Suhrer See fungieren ebenfalls für weitere 6 % des Gesamteinzugsgebiet als Nährstoffsenken und entlasten somit auch den Behler See. Die geringe Wasseraufentshaltzeit von 0,5 Jahren bewirkt, dass die zugeführte Nährstofffracht verminderte Auswirkungen im Behler See hat.
Aufgrund der vorhandenen hohen Belastung durch die Schwentine beträgt der Anteil der Landwirtschaft im Teileinzugsgebiet an der Gesamtbelastung des Sees 10 % beim Phosphor und 21 % beim Stickstoff. Betrachtet man jedoch lediglich das Teileinzugsgebiet, so sind hier die Einträge aus der Landwirtschaft mit jeweils 72 % beim Phosphor und beim Stickstoff erheblich. Durch die geringe Nährstoffbindungsfähigkeit des Sandbodens im Einzugsgebiet haben menschliche Aktivitäten wie landwirtschaftliche Düngung und Abwasserbeseitigung für die Gewässer weitreichende Folgen. Der Abwasseranteil des Wassers, das dem See durch die Schwentine zugeführt wird, ist durch zahlreiche Kleinkläranlagen und die zentralen Kläranlagen Eutin und Malente mit einem Ausbaugrad von 35000 beziehungsweise 21000 EW erhöht (LANDESAMT FÜR NATUR UND UMWELT 2001). Im Teileinzugsgebiet des Behler Sees spielt die Abwasserbeseitigung nur eine untergeordnete Rolle.
Der See zeigt typische Merkmale eines schwach eutrophen Sees. Der Stoffhaushalt des Sees ist durch ein Ungleichgewicht von Produktion und Abbau geprägt, das im Verlauf der sommerlichen Schichtungsphase zu Sauerstofffreiheit im Tiefenwasser und infolgedessen zu Nährstofffreisetzungen aus dem Sediment führt. Aufgrund der stabilen Schichtung des Sees stehen jedoch die rückgelösten Nährstoffe den Algen in den oberen Wasserschichten in der Vegetationsperiode nicht zur Verfügung.
Die Dominanzverhältnisse im Phyto- und Zooplankton sowie die saisonale Artenfolge charakterisieren den Behler See als eutrophen geschichteten See. Nach WILLEN (2000) liegt das Biovolumen des Sees im charakteristischen Bereich eines schwach eutrophen ("eutroph 1") Sees. Im Behler See wurde die sommerliche Phytoplanktongemeinschaft von Anabaena flos-aquae/Anabaena spiroides var. tumida, Aphanizomenon spp. und Microcystis aeruginosa bestimmt. Eine sommerliche Dominanz von Cyanobakterien und/oder Dinoflagellaten (vor allem Ceratium spp.) wird häufig in eutrophen, geschichteten Seen beobachtet, in denen es im Verlauf der Vegetationsperiode zu einer Verarmung an verfügbarem Phosphor kommt (SOMMER et al. 1986). Microcystis aeruginosa, Microcystis viridis und Microcystis wesenbergii sowie Aphanizomenon flos-aquae. und Anabaena spp. gelten als typische Blaualgenvertreter in eutrophen Gewässern, in denen sie auch beachtliche Anteile an der Biomasse bilden können (REYNOLDS 1997, LEPISTO & ROSENSTRÖM 1998, TRIFONOVA 1998). Das Wachstum des Phytoplanktons, das durch die Nährstoffsituation begünstigt ist, wird zwar in einem gewissen, aber nicht mehr im optimalen Maße durch die vorhandenen räuberischen Zooplanktonarten begrenzt.
Die weite Ausdehnung des Litorals im Vergleich zu anderen Seen - der Übergang zum Profundal befindet sich zwischen 8 m und 10 m - sowie das Auftreten von mesotrophen Charakterarten lassen einen eher mesotrophen Zustand erkennen. Aufgrund der Besiedlung des Profundals ist der See nach THIENEMANN (1922) als mäßig eutropher Chironomus anthracinus-See zu beurteilen. Ein Vergleich mit den Ergebnissen von LUNDBECK (1926), lässt die Aussage zu, dass sich der Zustand des Sees, in Bezug auf die Fauna des Seegrundes, nicht verschlechtert hat.
Ein Röhrichtgürtel fehlt über weite Strecken fast vollständig. Die existierenden Röhrichte sind häufig lückig und inselhaft, am Südufer konnte ein stärkerer Bestandsrückgang beobachtet werden. Dem Schilfrückgang liegt in der Regel das Abknicken der Schilfhalme zugrunde, das verschiedene Ursachen haben kann: direkte Zerstörung, mechanische Belastung, Fraßschädigung, Nährstoffbelastung der Röhrichte sowie Seespiegelmanipulation. Die Ursache für den gestörten Röhrichtbestand am Behler See kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht geklärt werden, möglicherweise kommt es zu einer Schädigung des Röhrichts durch mechanische Belastung infolge Schiffsverkehr und Fraßschädigung durch Rinder und Wasservögel. So wurde der Behler See z.B. 1999 von 54 Graugänsepaaren als Brutplatz bzw. von 110 Graugänsen als Mauserplatz genutzt (KOOP 1999a, KOOP 1999b). Mausernde Graugänse ernähren sich zwar an vielen Stellen im Grünland, an einigen Mauserplätzen jedoch auch von Jungschilf.
Eine Schwimmblattzone lässt sich nur punktuell in geschützten Lagen finden.
Positiv zu bewerten ist die mäßig artenreiche, gut entwickelte Unterwasservegetation, die aus 14 Arten besteht, von denen fünf gefährdet beziehungsweise vom Aussterben bedroht sind. Die Tiefenausdehnung und das Artenspektrum der submersen Vegetation ist typisch für ein eutrophes Gewässer. Besonders hervorzuheben sind die großflächigen Armleuchteralgenrasen. Der Erhalt der submersen Vegetation ist im Behler See von landesweiter Bedeutung.
8.5.2 Empfehlungen
Da der See gute Regenerationschancen hat, sind Entlastungsmaßnahmen hier besonders Erfolg versprechend. Aus fachlicher Sicht ist ein meso- bis schwach eutropher Zustand anzustreben. Somit ist der Istzustand dem guten ökologischen Zustand schon sehr nahe. Trotzdem sollten Maßnahmen zur Entlastung des Sees ergriffen werden, da die untersuchten Lebensgemeinschaften Defizite aufwiesen. Dabei sind die für die Seen der oberen Schwentine vorgeschlagenen Maßnahmen am wichtigsten. Aber auch im direkten Einzugsgebiet des Behler Sees ist es sinnvoll, Maßnahmen umzusetzen.
Entsprechend des hohen Anteils der landwirtschaftlichen Nutzung im Teileinzugsgebiet des Sees sind zu seiner Entlastung in erster Linie Maßnahmen in diesem Bereich zu ergreifen. Vordringlich sollte hierbei die seenahe Nutzung berücksichtigt werden.
Die Aufhebung der Beweidung der Seeufer und der Beseitigung der Viehtränken im See, die durch Weidepumpen ersetzbar wären, würde den Nährstoffeintrag in den See reduzieren und zum Uferschutz beitragen.
Die Änderung bzw. eine Reduzierung der Düngung am Nordufer, die laut Anwohner sehr früh im Jahr stattfindet und intensiv ist, würde zur Entlastung des Sees beitragen.
Eine Änderung der bisherigen Ackernutzung oder die Anlage hangparalleler Furchen auf den Ackerflächen bzw. von Knickwällen am nördlichen Westufer und am Ostufer des Sees ist aus Sicht des Gewässerschutzes anzuraten.
Das Schaffen von Uferrandstreifen würde zu geringeren Nährstoffeinträgen in das jeweilige Gewässer führen.
Die Beweidung der Ufer der östlichen Halbinsel am Nordufer sollte aus Artenschutzmaßnahmen beibehalten werden, da die stark gefährdete Zusammengedrückte Quellbinse Blysmus compressus hierdurch bessere Lebensbedingungen findet. Diese Beweidung sollte jedoch in ihrer jetzigen Intensität nicht überschritten werden.