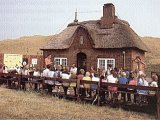Naturschutzgebietsausweisung - eine Aufgabe des LANU
Reinhard Schmidt-Moser
Seit dem 1. Februar 1997 ist das Landesamt für Natur und Umwelt zuständig für die Verfahren zur Ausweisung von Naturschutz- gebieten. Diese Aufgabe wurde vom Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten durch Verordnung auf das Landesamt übertragen.
Warum werden Naturschutzgebiete ausgewiesen?
"Gebiete, in denen ein besonderer Schutz der Natur in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen
- zur Erhaltung oder Entwicklung bestimmter oder vielfältiger Pflanzen- und Tiergesellschaften und ihrer Lebensräume oder bestimmte Pflanzen- oder Tierarten und ihrer Bestände,
- wegen ihrer Seltenheit oder Vielfalt ihres gemeinsamen Lebensraumes,
- wegen ihrer besonderen Eigenart und Schönheit oder
- aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen
erforderlich ist, können durch Verordnung der obersten Naturschutzbehörde zu Naturschutzgebieten erklärt werden."
Der erste Absatz des Paragraphen 17 des Landesnaturschutz- gesetzes beschreibt, welche Voraussetzungen ein Gebiet erfüllen muß, um als Naturschutzgebiet ausgewiesen zu werden. Ziel ist es, Ökosysteme wegen ihrer Seltenheit, Vielfalt, ihrer besonderen Eigenart und Schönheit oder aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen zu erhalten und zu entwickeln. Ein Ökosystem umfaßt den Lebensraum und die dazugehörige Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren. Vielfalt bedeutet: Es sollen möglichst alle Pflanzen und Tiere, die zu einer bestimmten Lebensgemeinschaft an einem von natürlichen Faktoren geprägten Lebensraum gehören, vorhanden sein. In extremen Lebensräumen, wie Hochmooren und Watt kommen natürlicherweise relativ wenige Arten vor, teilweise sind diese Arten aber in großer Individuenzahl vertreten. Es gilt daher, die für den jeweiligen Lebensraum charakteristische Lebensgemeinschaft vollständig zu erhalten oder wiederherzustellen.
Bevor ein Naturschutzgebiet ausgewiesen wird, muß zunächst dessen Schutzwürdigkeit bestätigt werden. Außerdem wird untersucht, ob das Gebiet mit seinen Lebensgemeinschaften bedroht oder gefährdet ist. Nur wenn diese Gefahr besteht oder zu befürchten ist, wird die Naturschutzbehörde aktiv. Ein Vergleich mit der Vergangenheit zeigt häufig, daß sich Lebensräume negativ verändert haben oder - präziser - verändert wurden. Typische Tiere und Pflanzen sind verschwunden oder selten geworden.
Ein weiterer Schritt ist es, zu erkennen, welche Faktoren dazu geführt haben, daß die zu einem bestimmten Lebensraum gehörende Lebensgemeinschaft teilweise verschwunden ist. Warum sind auf einem ruhig gelegenen See während des Herbstzuges kaum noch Wasservögel anzutreffen? Warum fehlen in einem Laubwald der prächtige Eichenbockkäfer und der Schwarzspecht, die dort eigentlich zu erwarten sind? Warum sind auf der Wiese keine Kiebitze mehr, von Rotschenkeln oder Bekassinen gar nicht zu reden? Warum hat sich die Wasserqualität des Baches so sehr verschlechtert, daß Flußkrebse und Muscheln verschwunden sind? Die Ursachen liegen in der Regel im menschlichen Handeln.
Deshalb können in Naturschutzgebieten Eingriffe des Menschen, die dem Schutzzweck widersprechen, geändert oder auch beendet werden. Dies sind beispielsweise land- oder forstwirtschaftliche Nutzung, Jagd, Fischerei, Wassersport oder andere menschliche Aktivitäten, die die Natur betreffen. Die vorgesehenen Einschränkungen müssen in jedem Einzelfall erforderlich, geeignet und angemessen zur Erreichung des Schutzzwecks sein.
In Naturschutzgebieten sollen Ökosysteme und deren natürliche Entwicklung dauerhaft bewahrt werden. In natürlichen oder sehr naturnahen Lebensräumen steht dabei nicht die Konservierung eines bestimmten Zustandes im Vordergrund. Vielmehr sollen möglichst die natürlichen Faktoren zugelassen werden, die das Ökosystem in die Lage versetzen, sich selbst zu regulieren und damit auf Einflüsse zu reagieren. Solche Einflüsse können extreme Witterungen wie besonders kalte Winter, trockene Sommer oder Nährstoffeinträge sein. Lebensräume wie Moore oder Seen "funktionieren" generell auch ohne den Menschen. Nur wenn wir der Natur Raum zur Eigendynamik zurückgeben, können wir wenigstens in kleinen Resten natürliche Lebensräume und die sie besiedelnden Pflanzen und Tiere dauerhaft erhalten. Dagegen sind in kulturgeprägten Ökosystemen, die durch menschliches Wirken entstanden sind, wie große Grünlandbereiche oder Heiden, weiterhin landwirtschaftliche Nutzungen zur Pflege und zur Aufrechterhaltung des Schutzzieles erforderlich.
Zu Beginn eines Verfahrens ist in jedem Fall zu klären, was das Schutzziel sein soll. Ist es die:
- natürliche Entwicklung
- dann sind künstliche Einflüsse auf das Naturschutzgebiet fernzuhalten.
- Erhaltung einer alten Kulturlandschaft
- dann sind Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen zuzulassen und die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Auch der Rat der Europäischen Kommissionen hat 1979 die Notwendigkeit gesehen, spezielle Schutzgebiete auszuweisen. Mit der Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) wurde zunächst eine Gruppe von Wirbeltieren besonders geschützt. Auch hier setzte sich die Erkenntnis durch, daß es nicht ausreicht, für bedrohte Vogelarten Schutzgebiete auszuweisen, um ganze Ökosysteme zu erhalten. Deshalb hat der Rat am 21. Mai 1992 die Richtlinie 92/42/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, die sogenannte Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie (FFH-Richtlinie) erlassen. Mit dieser Richtlinie soll ein zusammenhängendes Netz von ausgewählten Ökosystemen errichtet werden. Die Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, der Kommission Schutzgebiete zu benennen. Diese überprüft die Eignung der Gebiete und stellt sie in einer Liste zusammen. Mit der Eintragung unterliegen sie dem Schutz der FFH-Richtlinie. Dieser Schutzstatus entspricht - verkürzt - dem eines Naturschutz- gebietes. Weitere Bestimmungen der FFH-Richtlinie schreibt das deutsche Naturschutzrecht in ähnlicher Form vor wie beispielsweise die Eingriffsregelung, die Prüfung auf Verträglichkeit bei Eingriffen und das Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz). Bei geplanten Eingriffen muß das Ergebnis der Prüfung auf Verträglichkeit der Kommission vorgelegt werden. Alle benannten Schutzgebiete nach der Vogelschutzrichtlinie sind automatisch auch Schutzgebiete gemäß der FFH-Richtlinie.
Da kein Verfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Benennung der FFH-Gebiete vorgesehen ist, hat sich das Umweltministerium entschlossen, zunächst nur solche Gebiete vorzuschlagen, die ein Verfahren zur Ausweisung als Naturschutzgebiet durchlaufen haben. In diesem Verfahren hat eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden und der Schutz des Gebietes ist von vergleichbarer Qualität. So umfaßte die erste Nennung Schleswig-Holsteins den Nationalpark Schleswig- Holsteinisches Wattenmeer und 95 Naturschutzgebiete. Weitere Gebiete werden folgen. Diese müssen allerdings eines der folgenden Kriterien erfüllen: es sind landeseigene Flächen oder Flächen, die zuvor als Naturschutzgebiet mit dem Hinweis auf die FFH-Würdigkeit ausgewiesen wurden oder ausgewählte Flächen, die dem gesetzlichen Schutz des Paragraphen 15 a des Landesnaturschutzgesetzes unterliegen.
Wie werden Naturschutzgebiete ausgewiesen?
Der Paragraph 53 des Landesnaturschutzgesetzes regelt das Verfahren zur Ausweisung von Naturschutzgebieten. In einer Vorbereitungsphase werden alle Informationen über das Gebiet zusammengetragen. Das sind sowohl Daten zur Tier- und Pflanzenwelt, als auch über alle Nutzungen: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft, Fischerei und Freizeitaktivitäten und die Rechtsverhältnisse, die diesen Nutzungen zugrunde liegen. Auf dieser Grundlage wird von der Bearbeiterin oder dem Bearbeiter im LANU ein erster Entwurf der Landesverordnung über das zukünftige Naturschutzgebiet erarbeitet. Zunächst werden Behörden, öffentliche Planungsträger (zum Beispiel die Telekom) sowie die anerkannten Naturschutzverbände um eine Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung gebeten. Diese werden geprüft und gegebenenfalls in einen neuen Verordnungsentwurf aufgenommen. Der so überarbeitete Entwurf wird dann für einen Monat öffentlich in der örtlichen Amts-, Gemeinde- oder Stadtverwaltung zur Einsicht ausgelegt. Alle Bürgerinnen und Bürger, Verbände oder anderen Stellen können dann schriftlich Bedenken und Anregungen bei der Naturschutzbehörde äußern. Die fristgerecht eingegangenen Einwendungen werden im LANU geprüft. Das Ergebnis wird den Betroffenen mitgeteilt.
Bei diesem Verfahren werden die Eigentümer erst recht spät über die Planungen der Naturschutzbehörde informiert. Dies hat zu Kritik geführt. Seit einigen Jahren wird deshalb noch vor Einleitung des Verfahrens eine öffentliche Informationsveranstaltung vor Ort durchgeführt, bei der "Roß und Reiter" genannt werden. Dabei bahnen sich erste Kontakte zwischen den Betroffenen und den Bearbeiterinnen und Bearbeitern im LANU an. Sie haben dadurch die Möglichkeit, aus der sonst unvermeidlichen Anonymität herauszutreten, was die sich anschließenden Gespräche für beide Seiten leichter macht. Hat es einmal persönliche Kontakte vor Ort gegeben, läßt sich manche Frage schnell am Telefon klären.
Einschränkungen oder gar Verbote landwirtschaftlicher oder jagdlicher Aktivitäten, die zum Teil seit Jahrzehnten ausgeübt wurden, treffen verständlicherweise auf den Widerstand der Betroffenen. Hier gibt es regelmäßig harte Konflikte zwischen den privaten Belangen und dem Wohl der Allgemeinheit. Viele Gespräche sind notwendig, um wenigstens die Begründung für das Handeln der Naturschutzbehörde deutlich werden zu lassen. Diese Methode erfordert eine hohe fachliche, insbesondere aber persönliche und menschliche Kompetenz von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn in der Regel geht es um sehr konfliktträchtige Gespräche mit Menschen, die sich häufig in ihrem ganz persönlichen Lebensbereich bedrängt oder auch in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht fühlen.
Der in den letzten etwa fünf Jahren eingeschlagene Weg der frühen Information und der direkten Gespräche erscheint erfolg- versprechend, um den aufbrechenden Konflikten die Spitze zu nehmen und eine Lösung zu finden.
Ausblick
1923, also vor 75 Jahren, wurde in Schleswig-Holstein das erste Naturschutzgebiet ausgewiesen. Trotz der heute (Stand: April 1998) 175 Naturschutzgebiete sind die Roten Listen nicht kürzer sondern länger geworden. Hat das Instrument "Ausweisung von Naturschutzgebieten" also versagt?
Früher beschränkte sich der amtliche Naturschutz fast ausschließlich auf die Ausweisung von Schutzgebieten. Schwerpunkt war die Bewahrung des Bestehenden. Die alten Verordnungen begnügten sich im wesentlichen damit, die direkte Beschädigung der Pflanzen ("Ausreißen") und Stören oder Töten der Tiere zu verbieten. Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Jagd und Fischerei wurden nicht eingeschränkt. Heute wissen wir, daß Schutzbestimmungen wesentlich umfassender angelegt werden müssen.
Erst mit Beginn der 70er Jahre, mit dem ersten Bundes- und den Landesnaturschutzgesetzen setzte sich der Naturschutz neue Ziele und kam aus dem "Reservat" Naturschutzgebiet heraus. Zwei neue Instrumente, die Eingriffsregelung und die Landschaftsplanung ergänzten die Schutzgebietsausweisung. Darüberhinaus wurden bestimmte Ökosysteme (zunächst Moore, Sümpfe und Brüche) unter gesetzlichen Schutz gestellt. Dies war die Konsequenz aus der Erkenntnis, daß mit Naturschutzgebieten allein dem Artensterben kein Einhalt geboten werden kann.
Gäste des Naturschutzgebietes Amrum-Odde werden fachkundig über das Gebiet informiert
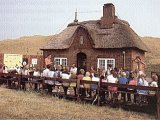
(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)
In einem weiteren Schritt gegen Ende der 80er Jahre wurden die Inhalte der Naturschutzgebiets-Verordnungen geändert. Die nun sehr viel weitergehenden Einschränkungen der Nutzungen durch Land- und Forstwirtschaft, durch Jagd und Fischerei, gelegentlich auch durch Freiluftsport können, abhängig vom Einzelfall, geeignet und erforderlich sein zur Erreichung des Schutzzwecks.
Die künstlich herbeigeführten Entwässerungen der vergangenen fünfzig bis hundert Jahre können leider nicht im Rahmen einer Naturschutzgebietsverordnung rückgängig gemacht werden. Hier müssen die Wasserbehörden, unter Einsatz des ihnen zur Verfügung stehenden wasserrechtlichen Instrumentariums, tätig werden. Häufig können nur mit ihrer Hilfe entwässerte Seen, Moore und Feuchtwiesen wieder ihren natürlichen Wasserstand zurückerhalten. Es zeigt sich, daß für einen erfolgreichen Naturschutz mehrere Behörden eng zusammen arbeiten müssen. Im LANU ist nun die Naturschutzbehörde mit den Behörden, die sich schwerpunktmäßig mit den Umweltmedien - Wasser, Boden, Luft - beschäftigen, zusammengefaßt. Dies schafft bessere Voraussetzung zur Realisierung eines umfassenden Naturschutzes.
In vielen Fällen bewirken die zur Erreichung des Schutzzwecks erforderlichen Einschränkungen heftige Kritik. Im Vergleich zu früher werden die Nutzungsmöglichkeiten der Grundeigentümer, im allgemeinen Landwirte, notwendigerweise deutlich stärker eingeschränkt. Die Rahmenbedingungen der Landwirtschaft, an denen sich die Bauern orientieren müssen und der umfassende Schutzzweck eines Naturschutzgebietes lassen sich heute nur schwer zur Deckung bringen. Dies bedeutet nicht ein generelles Aus für alle Nutzungen in künftigen Naturschutzgebieten. Wo ein Miteinander hinnehmbar, oder gelegentlich sogar erforderlich ist, kann das gemeinsame Ziel betont und verfolgt werden. In allen anderen Fällen muß in offenen und ehrlichen Gesprächen die Notwendigkeit einer Einschränkung der bisherigen Nutzung oder auch deren Beendigung begründet und ernsthaft nach einer akzeptablen Lösung gesucht werden. Es können zum Beispiel die Flächen im gegenseitigen Einvernehmen, etwa von der Stiftung Naturschutz, angekauft werden. Bei Bedarf wird auch Tauschland zur Verfügung gestellt.
Häufig erfordern akzeptable Lösungen die Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel, sei es für den Erwerb der Flächen oder für Entschädigungen. Wenn die Gesellschaft die Bewahrung der einheimischen Natur verlangt, und niemand wird sich wundern, wenn das LANU die Realisierung dieser Forderung als seine Aufgabe ansieht, dann muß die Gesellschaft den Eigentümern und Nutzern den notwendigen Verzicht finanziell ausgleichen.