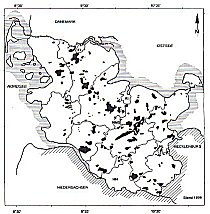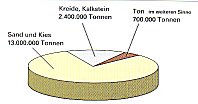Damit der Kies nicht ausgeht - Nachhaltige Sicherung von Rohstoffen
Erhard Bornhöft, Dr. Peter Sänger-von Oepen, Dr. Reiner Schmidt
Viele nehmen an, daß die Rohstoffe für Baumaterialien wie Beton, Ziegel oder Zement, aus denen unsere Gebäude und Verkehrswege bestehen, einfach vorhanden und stets schnell und problemlos zu beschaffen sind. Nur wenige bedenken jedoch, daß es durchaus zu Versorgungsengpässen kommen kann und daß die Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit heimischer Rohstoffvorkommen von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung ist.
Die Verfügbarkeit von Rohstoffen ist keineswegs unbegrenzt. In Schleswig-Holstein gibt es nicht erst seit heute regional Engpässe, zum Beispiel in den Sand-/Kieslagerstättengebieten bei Schmalstede/Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder bei Rastorf (Kreis Plön). Ursache sind einerseits der bereits erfolgte Abbau hochwertiger Rohstoffe, andererseits gibt es zunehmende Schwierigkeiten bei der Erschließung neuer Abbauflächen. Dies ist eine Folge des Anspruchs unserer Gesellschaft auf einen verstärkten Schutz der Natur und Umwelt.
Das natürliche Rohstoffangebot hängt vom geologischen Aufbau ab. Nutzbare Vorkommen, das heißt Lagerstätten, sind standortgebunden und ungleichmäßig verteilt. Sie können somit nur in bestimmten Gebieten und nicht an beliebiger Stelle erschlossen werden. Lange Transportwege zum Verbraucher verursachen nicht nur hohe Kosten und höhere Umweltbelastungen, sondern führen auch nur zu einer örtlichen Verlagerung von Eingriffen in den Naturhaushalt. Deshalb sollte die erforderliche Versorgung insbesondere mit Massenrohstoffen wie Sand oder Kies möglichst aus verbrauchernahen Lagerstätten erfolgen.
Eine Aufgabe der Landes- und Regionalplanung ist es, die räumliche Struktur des Landes Schleswig-Holstein natur- und umweltgerecht zu erhalten, zu entwickeln und mit den Bedürfnissen des Menschen abzustimmen. So ist neben dem dauerhaften Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens auch für eine umwelt- und sozialverträgliche wirtschaftliche und technologische Entwicklung zu sorgen. Hierzu gehört auch die langfristige, ausreichende und verbrauchernahe Sicherstellung der Versorgung der heimischen Wirtschaft mit oberflächennahen mineralischen Rohstoffen durch eine ausgewogene und am volkswirtschaftlichen Bedarf ausgerichtete Ausweisung von Rohstoffsicherungsgebieten.
Erkundung oberflächennaher Rohstoffe
Der oberflächennahe geologische Bau von Schleswig-Holstein wurde vor allem durch eiszeitliche Vorgänge geprägt. So entstand das 30 bis 40 Kilometer breite Östliche Hügelland mit seinen Endmoränen aufgrund von Gletscherbewegungen während der letzten Eiszeit. Die Moränen bestehen je nach Entstehung aus Gemengen von Ton, Sand, Kies und Steinen. Im Raum Lübeck wurden in Eisstauseen Tone abgelagert. Westlich der Endmoränenlandschaft des Hügellandes liegen in einem 15 bis 30 Kilometer breiten Gürtel Schmelzwasserablagerungen aus Sanden und Kiesen, die aus zahlreichen Gletschertoren geschüttet wurden. Weiter nach Westen folgt ein 15 bis 40 Kilometer breites Band mit sand- und kieshaltigen Moränen der vorletzten Eiszeit. In der 5 bis 30 Kilometer breiten Marsch wurden von der Nordsee in der Nacheiszeit meist tonige Ablagerungen angelandet.
Im tiefen Untergrund sind mehr als 1.000 Meter mächtige Salzablagerungen flächenhaft verbreitet. Hier kam es entlang von alten Bruchstellen zum Aufstieg von Salzgestein mit den darüberliegenden Festgesteinen. Örtlich wurden dadurch Gesteine der Kreidezeit und des Perm, die sonst kilometertief liegen, bis an die Erdoberfläche emporgedrückt. Beispiele sind die Kreidekalke bei Lägerdorf oder der Kalkberg in Segeberg.
Der Geologische Dienst Schleswig-Holstein erkundet seit 1981 systematisch die oberflächennahen Rohstoffe im Lande. In den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten werden oberflächennahe Rohstoffe wie Ton, Sand, Kies und Kalkstein erfaßt, abgegrenzt und bewertet:
- Die Fachleute des LANU sichten zunächst alle vorhandenen Unterlagen - wie Fachliteratur, Berichte, Gutachten, Bohrprotokolle, Geologische Karten und Lagerstättenkarten. Hierbei dient insbesondere das Geologische Landesarchiv des LANU als wichtigste Informationsquelle.
- Anschließend führen sie Untersuchungen im Gelände durch, um die oberflächennahen Rohstoffe besser abgrenzen zu können. Es werden geoelektrische Tiefensondierungen vorgenommen sowie eine begrenzte Anzahl an Bohrungen niedergebracht.
- Außerdem befragen sie in Schleswig-Holstein ansässige Firmen nach vorhandenen geologischen Daten.
- Schließlich schätzen sie die Menge und die Qualität des Rohstoffvorkommens ab. Dies geschieht auf der Grundlage geologischer Vergleichsbetrachtungen, geophysikalischer, gesteinskundlicher und erforderlichenfalls chemischer Untersuchungen.
Das Ziel dieser Untersuchungen ist es, eine erste systematische Übersicht der Rohstoffvorkommen in Schleswig-Holstein zu erhalten. So werden in Berichten und Karten einheitliche Planungsgrundlagen für das gesamte Land geschaffen. 1997 wurde die rohstoffgeologische Bearbeitung des Kreises Rendburg- Eckernförde abgeschlossen. Jetzt müssen nur noch die rohstoffgeologischen Berichte für die Kreise Steinburg und Dithmarschen fertiggestellt werden.
Übersicht der Vorkommen oberflächennaher mineralischer Rohstoffe in Schleswig-Holstein
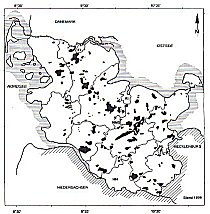
(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)
Rohstoffgewinnung
In Schleswig-Holstein werden jährlich etwa 16 Millionen Tonnen Steine- und Erden-Rohstoffe im Tagebau gefördert, das heißt pro Jahr rund 6 Tonnen je Einwohner. Sande und Kiese machen etwa 80 Prozent der Produktion aus. Die restlichen 20 Prozent verteilen sich auf Ton- und Kalkrohstoffe. Aus diesen Rohstoffen werden in erster Linie wichtige Baustoffe wie Zement, Beton, Mörtel, Ziegeleierzeugnisse, Kalksandsteine, Porenbetonsteine, Dachbetonsteine, Straßen- und Deponiebaumaterialien hergestellt. Sie werden aber auch für spezielle Zwecke in anderen Wirtschaftsbereichen, im Umweltschutz sowie in der Land- und Forstwirtschaft verwandt, beispielsweise als Füllstoffkreide oder Düngekalke.
Gewinnung von oberflächennahen mineralischer Rohstoffe in Schleswig-Holstein im Jahr 1990
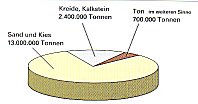
(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)
Die Industrie der Steine und Erden ist mit 300 bis 400 überwiegend klein- und mittelständischen Betrieben ein wichtiger Faktor der schleswig-holsteinischen Wirtschaft. Nach Angaben aus dem Statistischen Jahrbuch 1996 erzielten Steine und Erden gewinnende und verarbeitende Betriebe (20 und mehr Mitarbeiter) 1996 mit insgesamt 4.934 Beschäftigten einen Gesamtumsatz in Höhe von rund 1,8 Milliarden Mark. Dies entspricht einem Anteil von etwa 16 Prozent des insgesamt erwirtschafteten Umsatzes im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe.
Um die Vorräte an mineralischen Primärrohstoffen zu schonen, werden in der Bauwirtschaft auch Sekundärrohstoffe, das sind Baureststoffe oder industrielle Nebenprodukte oder nicht- mineralische Rohstoffe wie beispielsweise Holz, verwandt. Zur Zeit werden bundesweit weniger als 10 Prozent der Rohstoffe durch Recyclingprodukte ersetzt. Dabei werden bereits heute einzelne Stoffgruppen wie Straßenaufbruchmaterial, Schmelzkammer- granulate, Schlacken und REA-Gips nahezu vollständig wiederverwertet. Eine kurzfristige Steigerung ist kaum möglich. Selbst optimistische Schätzungen gehen bei Bündelung verschiedener Substitutionsmaßnahmen mittelfristig von einem Ersatz von nur 10 bis 15 Prozent aus. Deshalb werden auch zukünftig unverändert große Mengen mineralischer Primärrohstoffe benötigt.
Rohstoffsicherung
Auch wenn die naturgegebenen Rohstoffvorkommen weitgehend bekannt sind, so reicht dieses Wissen noch nicht aus, um die für eine langfristige und geordnete Versorgung der Bauwirtschaft notwendigen Rohstoffgebiete planerisch sichern zu können. Die Planungsträger auf Regional- und Landesebene benötigen dafür neben rohstoffgeologischen Daten insbesondere Informationen über rohstoff- bzw. volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Ende 1996 regten das Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr sowie die Landesplanungsbehörde an, für diese Fragestellungen eine Arbeitsgruppe sektorale Fachplanung Rohstoffsicherung in der Abteilung Geologie und Boden des LANU einzurichten.
Das übergeordnete Ziel einer sektoralen Fachplanung Rohstoffsicherung besteht darin, eine Analyse des derzeitigen und zukünftigen Bedarfs an Rohstoffen in den einzelnen Regionen Schleswig-Holsteins durchzuführen. Daraus soll der reale Flächenbedarf für eine langfristige und ausreichende Rohstoffsicherung abgeleitet werden. Gemäß des 1997 entwickelten Konzeptes für eine umfassende Bedarfsanalyse müssen zahlreiche Teilinformationen erarbeitet und zusammengeführt werden.
Dies sind die:
- Lage der ortsgebundenen Rohstoffpotentialgebiete in Schleswig-Holstein
- Lage der derzeitigen Rohstoffgewinnungsstellen und Darstellung der Produktionssituation
- Lage der (Haupt-)Verbraucherräume und Darstellung der Verbrauchssituation
- Ermittlung von Kennzahlen über den Pro-Kopf-Verbrauch von Rohstoffen
- Lieferbeziehungen zwischen Produktionsgebieten und Verbrauchsgebieten
- Berücksichtigung von Außen- und innerdeutschen Handelsbeziehungen
- Bilanzierung des Bauvolumens und langfristige Vorausschätzungen
- Zeitreihen über die Bevölkerungsentwicklung in Schleswig-Holstein
- Berücksichtigung des derzeitigen und zukünftigen Einsatzes von Recycling-Rohstoffen
- Ermittlung und Darstellung von Konfliktpotentialen bei konkurrierenden Nutzungsansprüchen
Die Abteilung Geologie und Boden des LANU recherchiert im wesentlichen in der Rohstoff- und Bauwirtschaft in Schleswig- Holstein und stellt die geographischen Zusammenhänge dar. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin ist mit statistischen Spezialuntersuchungen beauftragt worden. Konfliktpotentiale im Hinblick auf die Schutzgüter der Natur und Umwelt werden in enger Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen des LANU dargestellt. Dabei bleibt die Konfliktabwägung natürlich den Planungsträgern auf Landes- und Regionalebene vorbehalten.