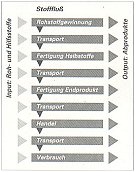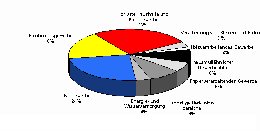Wege zur ökologischen Kreislaufwirtschaft
Dr. Norbert Kopytziok
Die ökologische Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, den Einfluß der Abfallwirtschaft für den vorsorgenden Umweltschutz zu nutzen. Schon im Abfallwirtschaftsprogramm der Bundesregierung von 1975 wurde der Grundsatz formuliert, vorrangig Abfälle zu vermeiden. Dieser Grundsatz ist in der Zwischenzeit häufig wiederholt, nicht aber realisiert worden. Mit der Verabschiedung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) im Jahr 1994 wurde erneut versucht, der Abfallvermeidung prioritäres Gewicht einzuräumen.
Abfallvermeidung als Bestandteil einer ökologischen Kreislaufwirtschaft
Mit der ökologischen Kreislaufwirtschaft will die Abfallwirtschaft einen Beitrag zum "sustainable development", einer nachhaltigen umweltverträglichen Entwicklung leisten.
Im Unterschied zu den Konzepten des klassischen Natur- und Umweltschutzes, mit denen Einzelprobleme zu lösen versucht wurden, werden im Kontext einer ökologischen Kreislaufwirtschaft alle umweltrelevanten Bereiche entlang einer Produktlebenslinie untersucht.
Untersuchungsspektrum einer Produktlebenslinie
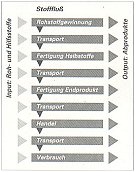
(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)
Betrachtet man eine solche Produktlebenslinie so fallen viele verschiedene Problembereiche auf. Die Lebenslinie von Papier beginnt zum Beispiel bei der Forstwirtschaft. Sie führt weiter über die Zellstoff- und Papierherstellung zum Druckgewerbe, dem Handel und Gebrauch bis hin zur Abfallbeseitigung. Hinzu kommen die Transporte und die Energieerzeugung sowie der Gebäude-, Straßen-, Maschinen- und Fahrzeugbau. Für die Papierproduktion, wie auch für alle anderen Produktionsprozesse, werden Roh- und Hilfsstoffe benötigt und Abprodukte in die Umwelt abgegeben. Somit nimmt der Herstellungsprozeß Einfluß auf das Klima und auf Wasser-, Boden- und Luftbelastungen. Auch den Menschen gefährdende Faktoren wie Lärm werden erzeugt. In den USA werden zudem die Arbeitsunfälle miteinbezogen. Unter Betrachtung all dieser Aspekte stellen die festen Abfälle nur ein kleines von vielen ökologischen Problemen dar.
Eine umweltschonende Abfallbehandlung bedeutet nach den besten Entsorgungswegen zu suchen. Vermeidung hingegen verlangt eine Auseinandersetzung mit dem "Woher kommt der Abfall?".
Betrachtet man die Herkunftsbereiche der Siedlungsabfälle zusammen mit den Abfällen aus dem produzierenden Gewerbe, ergeben sich für Schleswig-Holstein drei Schwerpunkte. Von den knapp fünf Millionen Tonnen an Abfällen und Wertstoffen, die 1993 in Schleswig-Holstein ohne Bodenaushub angefallen sind, stammen 26 Gewichtsprozent aus privaten Haushalten und dem Kleingewerbe, 24 Gewichtsprozent aus dem Bau- sowie 18 Gewichtsprozent aus dem Ernährungsgewerbe.
Abfall- und Wertstoffmengen nach Herkunftsbereichen in Schleswig-Holstein in Gewichtsprozent
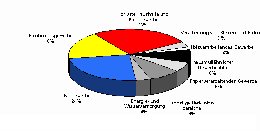
(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)
Die Auseinandersetzung mit der Herkunft der Abfälle lenkt den Blick auf alle Abläufe, die der Abfallentstehung vorangegangen sind. Mit dieser erweiterten Sicht tastet sich die Abfallwirtschaft an eine ökologische Stoffwirtschaft heran, die erfolgsversprechend erscheint. Betrachtet man die Produktlebenslinie des Papiers erweist sich der Zellstoffherstellungsprozeß als größtes Problem. Die umweltbezogene Auseinandersetzung führte dazu, daß die Papierfabriken immer weniger chlorgebleichten Zellstoff einsetzen, sondern verstärkt Wasserstoffperoxid zum Bleichen verwenden.
Dieses Beispiel verdeutlicht, daß prozeßbezogene Umweltschutzmaßnahmen in der Regel mehr als eine Abfallfraktion behandeln und auch in mehreren Umweltmedien wirksam sein können. Neuere Konzepte werden daher zunehmend medienübergreifend auf der Ebene von Bedürfnisfeldern angelegt. Als Bedürfnisfelder werden beispielsweise gesellschaftliches Zusammenleben, Kleidung, Gesundheit, Ernährung, Wohnen, teilweise auch Mobilität verstanden. Ausgehend von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Schutz des Menschen und der Umwelt", arbeiten immer mehr Umweltinstitute an der ökologischen Optimierung ganzer Bedürfnisfelder. Das Wuppertal-Institut veröffentlichte, daß 32 Prozent des gesamten Primärenergieverbrauches in den alten Ländern der Bundesrepublik dem Bedürfnisfeld Wohnen und 20 Prozent dem Bedürfnisfeld Ernährung zuzuordnen sind.
Der Primärenergieverbrauch für Transport wurde nicht als eigenes Feld aufgeführt, sondern den anderen Bedürfnisfeldern zugeordnet. Mobilität in Form von Verkehr stellt sich als besonders umweltbelastend heraus und ist somit ein zentrales ökologisches Problem unserer Zeit:
- für die Herstellung eines Mittelklasse-Personenkraftwagen wird soviel Energie aufgewendet, wie für die Verpackungen, die eine Person in fast 20 Jahren verbraucht,
- die Energie, die für das Fahren von 800 Kilometern mit diesem Wagen verbraucht wird, ist so groß wie für die Herstellung aller Verpackungen pro Person und Jahr benötigt wird,
- mit der Verringerung des Benzinverbrauchs von nur einem Liter pro 100 Kilometer kann eine Einsparung erzielt werden, die die Produktion eines Personenkraftwagens ermöglichen würde,
- die mit der Herstellung und dem Gebrauch des Autos verbundenen Abfälle ergeben umgerechnet fast einer Tonne pro Person und Jahr. Dies ist mehr als die durchschnittliche Menge an Siedlungsabfällen.
In der abfallwirtschaftlichen Praxis hat sich diese Erkenntnis bei den Ökobilanzen von Getränkeverpackungen niedergeschlagen. Die ökologiebezogene Einweg-/Mehrwegdiskussion hat gezeigt, daß die Transportentfernung maßgeblicher ist als die Wahl des Verpackungssystems. Diese Dominanz bei den Umweltauswirkungen nimmt das Transportwesen generell ein. Deshalb ist es gerechtfertigt auf eine Minimierung des Transportes hinzuwirken. Der ökologische Landbau in Verbindung mit der Vermarktung regionaler Produkte sollte deshalb bevorzugt gefördert werden.
Ein weiteres Bedürfnisfeld, dem aus Sicht des Umweltschutz besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist, ist die Kommunikation. Mit dem Ausklingen des 20. Jahrhunderts entwickelt sich unsere Gesellschaft von einer Industrie- zu einer Kommunikationsgesellschaft. Dies kommt sowohl in der Masse an Printmedien, als auch in der rasanten Entwicklung der elektronischen Medien zum Ausdruck. Beide Kommunikationsmedien verursachen hohe spezifische Umweltbelastungen. Die Printmedien sind in der Vergangenheit wegen ihrer Schwermetallkonzentrationen thematisiert worden. Doch die Reduktion des Bleigehaltes in den Druckerfarben verbessert die ökologische Gesamtbilanz nur unmerklich. Neben den Farbpigmenten sind auch die Wasserbelastungen bei der Zellstoff- und Papierproduktion zu hoch. Bei den elektronischen Medien ist die immer geringer werdende Nutzungszeit das erschreckenste Phänomen. Auf diese Weise werden Rohstoffe verschwendet und aufwendig gefertigte elektronische Bauteile und Leiterplatten frühzeitig zu Sondermüll.
Da der Bereich der Kommunikation derzeit stark expandiert, ist ein umweltbewußtes Handeln besonders wichtig.
Beitrag der Abfallwirtschaft zur Verringerung von Umweltbelastungen
Maßnahmen der Abfallvermeidung und -verwertung sollen helfen Umweltbelastungen zu verringern. Während die Entlastungseffekte der Verwertung umstritten sind, gelten Maßnahmen der Vermeidung als ökologisch sinnvoll. Allerdings wurden die beiden Begriffe bisher unterschiedlich angewendet und zum Teil mißbraucht. Unter Ableitung des Abfallbegriffes aus dem neuen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz lassen sich Vermeidungs- und Verwertungsaktivitäten klarer unterscheiden. Heute bezieht sich die Abfallvermeidung grundsätzlich auf die Vermeidung an der Quelle. Hierzu gibt es zwei zentrale Ansatzpunkte:
- Die quantitative Abfallvermeidung:
Mengenmäßige Reduktion der Produktherstellung und -vermarktung sowie Reduktion des Rohstoffeinsatzes pro Produkteinheit.
- Die qualitative Abfallvermeidung:
Reduktion des Schadstoffeinsatzes und -austrages bei der Produktion und Vermarktung von Gütern.
Eine Umweltentlastung läßt sich allerdings nur dann erzielen, wenn die erreichten Effekte nicht durch negative Auswirkungen an anderen Stellen kompensiert werden. So ist die Neueinführung von Mehrwegsystemen mit einer hohen Anfangsbelastung verbunden. Diese Belastung wird erst durch eine bestimmte Nutzungshäufigkeit zu einer Entlastung führen. Auch die häufig mit der Abfallvermeidung verbundene Öffentlichkeitsarbeit erzeugt Umweltbelastungen, die der Umstellung zur Vermeidung anzurechnen ist. Bei der Beurteilung abfallvermeidender Maßnahmen müssen deswegen auch die belastenden Aspekte berücksichtigt werden.
Maßnahmen der Abfallvermeidung setzen in der Regel bei einer Veränderung von Produkten, Produktion, Logistik und Konsumverhalten an. Abfallvermeidung umfaßt in Anlehnung an das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz unter anderem:
- abfallvermeidendes Produktdesign durch Langlebigkeit, Sparsamkeit im Verbrauch, Reparaturfreundlichkeit, Schadstofffreiheit,
- integrierte Produktionsprozesse mit sparsamen, im Kreislauf zu führenden Rohstoffeinsätzen je Produkteinheit,
- nutzungsorientierten statt besitzorientierten Konsum durch Teilen, Mieten, Tauschen von Waren, wie Car-Sharing oder Gebrauchtwarenbörsen.
In der Fachliteratur zur ökologischen Abfallwirtschaft wird allgemein eine 20-prozentige Vermeidung von Abfällen für möglich gehalten. Erkenntnisse aus der Ökobilanzierung lassen erwarten, daß durch die Vermeidung eines potentiellen Abfalls etwa eine zehnfach höhere Umweltentlastung eintritt, als wenn das Produkt entstanden und verwertet worden wäre.
Mit Hilfe einer konzentrierten Arbeit auf besonders umweltrelevanten Gebieten läßt sich unsere Industriegesellschaft von einer sozialen zu einer ökologischen Marktwirtschaft entwickeln. Voraussetzung dafür wird die in der Agenda 21 geforderte, ehrliche Kooperation zwischen Privatpersonen und Verantwortlichen in Forschung, Verwaltung und Wirtschaft sein. Eine solche konstruktive Auseinandersetzung erhöht die Chancen, beispielhafte Modelle im Umweltschutz zu realisieren.
Diese Überlegungen sollten künftig bei der finanziellen Förderung von Vorhaben aus Mitteln der Abfallabgabe berücksichtigt werden. Am 23. September 1997 stellt das LANU auf einer Veranstaltung erste konkrete Ansätze für eine ökologische Kreislaufwirtschaft in Schleswig-Holstein der interessierten Fachöffentlichkeit vor.