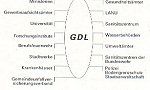EDV-Systeme für Gefahrstoffinformation und Überwachung
Lutz Erdmann
Die Aufgabenträger der öffentlichen Hand benötigen zur Sicherstellung des umweltgerechten und rechtskonformen Umgangs mit chemischen Stoffen einen effektiven Zugriff auf aktuelle, gesicherte und umfassende Stoffinformationen für die Gebiete:
- Überwachung,
- Genehmigung,
- Gefahrenbewertung,
- Schadensvermeidung und -bekämpfung,
- vorbeugenden Gesundheitsschutz.
Chemikalien- und spezielle Gefahrstoffdatenbanken leisten hierzu einen wichtigen Beitrag und helfen bei der Entscheidungsfindung und Bestimmung von Maßnahmen. Fachlich federführend für die Bereitstellung und Handhabung von Gefahrstoffdaten ist in Schleswig-Holstein das Umweltressort. In diesem Rahmen werden im LANU eine Reihe von Stoffinformationsystemen aus dem öffentlichen Sektor mitbetreut und verfügbar gehalten. Darunter finden sich solche, die von Einzelinstitutionen als "kleine Lösungen" für bestimmte, eng umrissene Problemstellungen entwickelt wurden, und andere mit globaler gefaßtem Informationsanspruch, die arbeitsteilig in übergreifenden Kooperationen auf Länder- oder Bund-/Länder-Ebene betrieben werden und dezentral erarbeitete Datenbestände integrieren. Ferner besteht die Möglichkeit für Online-Zugriffe auf nationale und internationale Chemikalien- und Umweltgroßdatenbanken über Datennetze.
Wichtige Chemikalieninformationssysteme im Bestand des LANU

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)
Gefahrstoffdatenbank der Länder (GDL)
Die GDL wird durch eine Facharbeitsgruppe mit der Aufgabe betrieben, Daten zu chemischen Stoffen und Zubereitungen zu erschließen und bereitzustellen. Ihr angeschlossen sind alle Bundesländer, das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, das Umweltbundesamt, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und der Hauptverband der Berufsgenossenschaften. Das Umweltressort wird in der Fachgruppe durch das LANU vertreten. Der Vorsitz der GDL liegt derzeit beim Bundesland Hessen.
Die Fachgruppe tagt in halbjährlichem Turnus zur Festlegung des weiteren Arbeitsprogramms und zur Steuerung der arbeitsteiligen ausgeführten Pflege und Fortschreibung von Datenbestand und Softwareanwendungen. Etwa zweimal jährlich werden die Arbeitsergebnisse der kooperierenden Institutionen zentral zusammengeführt und ein erneuertes Gesamtsystem erstellt. Die Verteilung in den Ländern übernehmen die jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter in der Fachgruppe. Das Informationsspektrum der GDL erstreckt sich unter anderem auf:

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)
Identifikation von Stoffen und Firmen, Zusammensetzung von Zubereitungen/Produkten, Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbekämpfung, Erste-Hilfe, Handhabung, Lagerung, Entsorgung, physikalische und chemische Eigenschaften, toxische Wirkungen, Einstufung und Kennzeichnung, Gesetzliche Regelungen und Vorschriften, Analyseverfahren, Richt- und Grenzwerte.
Die GDL steht für Einrichtungen der öffentlichen Hand kostenlos zur Verfügung. Die aktuelle Version 11 wird in Schleswig-Holstein von rund 40 Institutionen eingesetzt.
Einsatzbereiche der GDL in Schleswig-Holstein
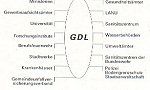
(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)
1996 wurde die seit längerer Zeit vorbereitete Umstellung auf ein erneuertes Datenhaltungssystem und Softwarepaket realisiert.
Die nunmehr verwendete neue Datenstruktur, an deren Entwicklung die ehemalige Untersuchungsstelle für Umwelttoxikologie richtungsweisend beteiligt war, ist so flexibel gestaltet, daß das inhaltliche Spektrum der Datenbank praktisch uneingeschränkt modifiziert werden kann, ohne Struktur- oder Softwareanpassungen nach sich zu ziehen. Da wichtige Partnersysteme der GDL, Gemeinsamer zentraler Stoffdatenpool Bund/Länder (GSBL) und das Informationsystem gefährliche/umweltrelevante Stoffe (IGS), nach gleichartigen Strukturprinzipien aufgebaut sind, wurde mit der Umstellung auch die Voraussetzung für den wechselseitigen, voll automatisierten Datentransfer geschaffen.
Der GDL-interne Datenaustausch, einschließlich des Aktualisierungsverfahrens, wird zukünftig ebenfalls weitestgehend automatisiert.
Da der Systemwechsel aufwendige Arbeiten, insbesondere eine Umstrukturierung der vorhandenen Faktendaten erforderlich machte, wurde von der Fachgruppe der halbjährliche Aktualisierungszyklus für 1996 ausgesetzt. So konnte mit den verfügbaren Personalkapazitäten bis zum Jahresende eine Prototypversion, GDL 12 beta, mit allerdings noch vermindertem Dateninhalt zur Erprobung fertiggestellt werden. Der volle Funktionsumfang wird voraussichtlich im Frühjahr 1997 erreicht sein. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Verteilung an die Endnutzer wieder aufgenommen. Seitens des LANU wurden 1996 folgende Beiträge zum Betrieb der GDL geleistet:
- Entwicklung des Importprogramms und einzelner Module für die Datenerfassung und das Datenbankmanagement des neuen Systems,
- Neugliederung von Daten zu physikalisch-chemischen Eigenschaften, Produktzusammensetzungen und Firmen,
- Erfassung von Strukturformeln chemischer Verbindungen,
- Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Identitätsdatenabgleich" und "Workshop GDL" (Implementierung der Version 12 beta),
- Leitung der Arbeitsgruppe Ökotoxikologie.
Ferner war das LANU an der Ausarbeitung von Vorschlägen zur Straffung von Verfahrensabläufen und Anpasssung der Zuständigkeitsverteilung in der Fachgruppe beteiligt. Für das Jahr 1997 ist geplant, die GDL nach Wunsch Nutzerinnen und Nutzern auch auf CD und in bedarfsangepaßten Teildatenbeständen zur Verfügung zu stellen.
Recherchesystem für EINECS und
Notifizierte Chemische Substanzen (RENOCS)
Das Chemikaliengesetz (ChemG) verpflichtet Hersteller und Einführer, alle chemischen Stoffe, die nicht im Europäischen Altstoffverzeichnis (EINECS) vermerkt sind, vor dem In-Verkehr-Bringen anzumelden. Die zuständigen Landesbehörden, in Schleswig-Holstein die Gewerbeaufsichts- und Gesundheitsämter, haben den Vollzug des Gesetzes und der darauf fußenden Rechtsverordnungen zu überwachen. Dies betrifft insbesondere auch die Einhaltung der Meldepflicht und zugelassenen Mengen. Als eine wesentliche Maßnahme werden von den Ämtern Betriebsinspektionen vorgenommen, deren Zweck es ist, Gesetzesverstößen vorzubeugen oder solche aufzudecken. Angesichts der Vielzahl existierender Handelsformen und Zubereitungen wird die effektive Kontrolle von Zielbetrieben vor Ort jedoch durch die aufwendige Feststellung der chemischen Identität der gehandhabten oder in Verkehr gebrachten Stoffe erschwert. Verfügbare Unterlagen und Nachschlagewerke in Papierform erweisen sich hierbei in der Praxis oft als unzureichende und schwer handhabbare Hilfsmittel.
Um diesem Problem zu begegnen, wurde von der Abteilung "Umwelttoxikologie", als "Leitstelle ChemG", zusammen mit der Anmeldestelle der BAuA ein kompaktes Recherchesystem für überwachungsrelevante Stoffe nach dem Chemikaliengesetz (RENOCS) realisiert, das speziell nach Inspektionserfordernissen ausgelegt ist und auf Laptop-Computern betrieben werden kann. Seine Datenbank, die sowohl das komplette EINECS als auch Schlüsselinformationen über die EU-weit gemeldeten Neustoffe enthält, ermöglicht die schnelle Identifizierung und Klärung der Anmeldepflichtigkeit von Stoffen und Produkten. Insgesamt hält das System rund 500.000 Stoffnamen zur Recherche bereit. Daneben bestehen Suchmöglichkeiten über Aktenzeichen und verschiedene Stoffkennummern. Ebenso sind Listen der Anmeldungen einzelner Firmen abrufbar.
Das System beruht auf einer Softwareentwicklung der Abteilung "Umwelttoxikologie" und Datenlieferungen der BAuA. Ein Prototyp wurde im Rahmen des europäischen Überwachungsprojekts "Farbstoffe" bereits Ende 1995 erfolgreich in Schleswig-Holstein eingesetzt. Von der Anmeldestelle wurde RENOCS mit aktualisierten Daten im Laufe des Jahres 1996 auch den übrigen Bundesländern zur Verfügung gestellt und befindet sich dort für Überwachungszwecke im Einsatz. Ein internationaler Erfahrungsaustausch von Überwachungsbehörden hat zudem gezeigt, daß das System auch im europäischen Maßstab als effizientes Hilfsmittel nutzbar und von Interesse ist.
Voraussetzung für den dauerhaften Einsatz von RENOCS ist jedoch die kontinuierliche Aktualisierung der Informationen über Neustoffanmeldungen. Seit Mitte 1996 befindet sich deshalb ein Kooperationsprojekt zwischen der Abteilung "Umwelttoxikologie", der Anmeldestelle (BAuA) und der Europäischen Kommission in Vorbereitung, das ein regelmäßiges Datenergänzungsverfahren durch das Europäische Büro für Chemische Stoffe, die Zentralstelle für Stoffanmeldungen in der EU, vorsieht. Ferner ist die Erweiterung des inhaltlichen Umfangs um die Stofflisten nach § 4a Gefahrstoffverordnung und Import/Export-Verordnung (2455/92 EWG) sowie die Weiterentwicklung der Software mit finanziellen Mitteln der Kommission und unter technischer Federführung des LANU geplant.